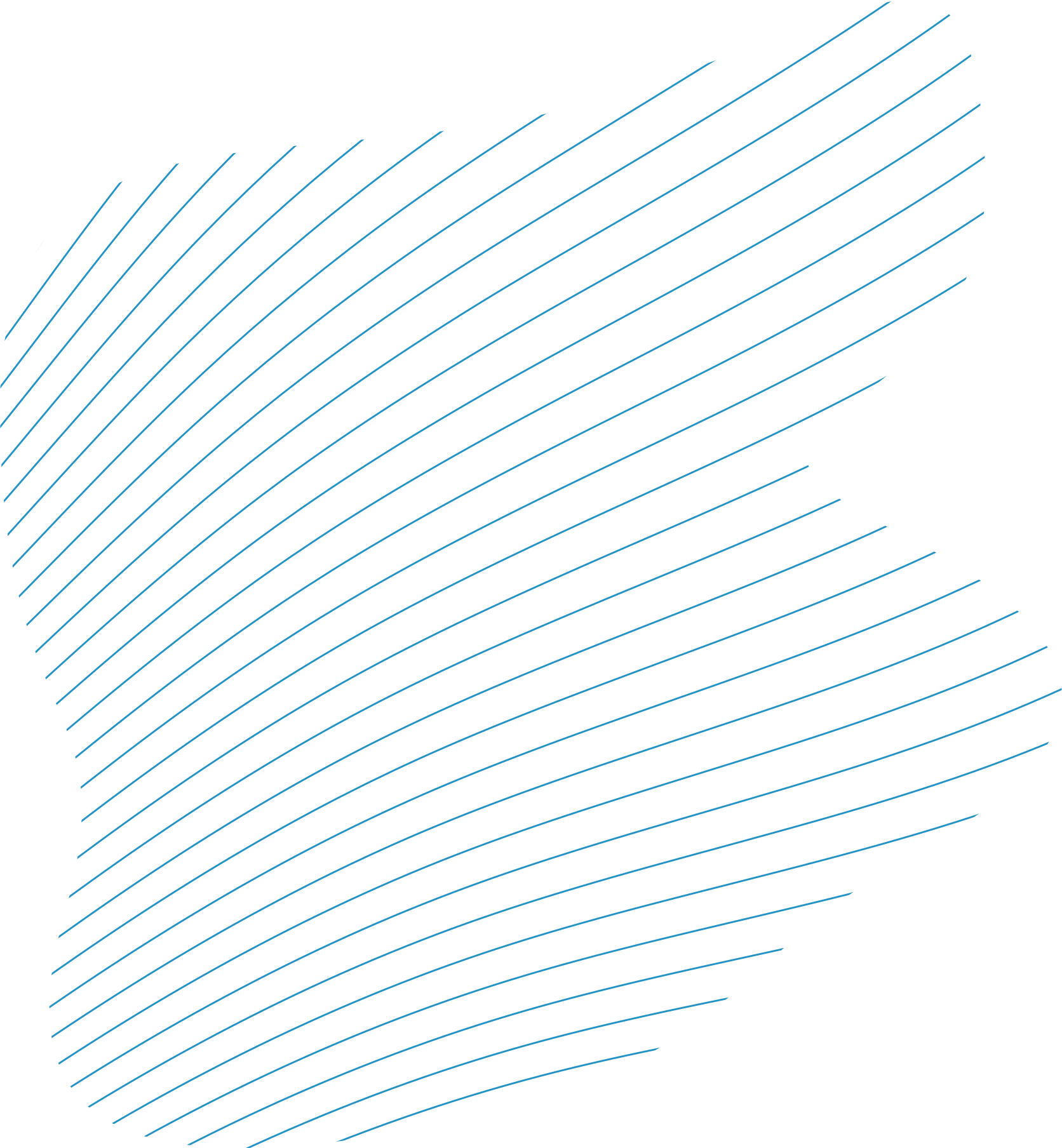Die Rekultivierung im rheinischen Braunkohlenrevier hat eine lange Tradition. Erste Auflagen und Aufforderungen zur Rekultivierung führen weit in die Vergangenheit zurück. Bereits im Jahre 1766 findet sich in einem Pachtvertrag für die Roddergrube die Auflage, die hinterlassene Grube mit Erlen aufzuforsten. Dabei ging es nicht um das Landschaftsbild oder gar ökologische Ansprüche, sondern um handfeste wirtschaftliche Gründe: Wald war ein wichtiges Wirtschaftsgut.
Das Allgemeine Berggesetz für Preußen (1865) verlangte ein Jahrhundert später eine ausdrückliche fachliche Kontrolle der Wiedernutzbarmachung. Dabei wachte die Bergbehörde über alle Maßnahmen der Oberflächengestaltung und -nutzung durch die Bergbaubetriebe nach dem Abbau der Braunkohle.
Um die Jahrhundertwende erreichte der Braunkohlenabbau industrielle Größenordnungen. Umso nachdrücklicher musste darauf Wert gelegt werden, die ausgekohlten Flächen wieder wirtschaftlich nutzbar zu machen. In einer „Bergpolizeiverordnung“ aus dem Jahre 1929 erließ das Oberbergamt Bonn: „Beim Braunkohlentagebau müssen alle Abraummassen in die ausgekohlten Tagebaue wieder so eingebracht werden, dass möglichst große land- und forstwirtschaftlich nutzbare Flächen entstehen.“
Bis zum Zweiten Weltkrieg konzentrierte sich die Wiedernutzbarmachung zu Recht auf die Herstellung neuer Waldflächen. Schließlich bewegte sich der Braunkohlenbergbau damals hauptsächlich auf dem bewaldeten Villerücken zwischen Bonn und Köln.
Erst als die Tagebaue nach Norden bis hin zu den ackerbaulichen Kerngebieten der Niederrheinischen Bucht vordrangen, änderten sich die Anforderungen an die Wiedernutzbarmachung. So kam es in den 1960er Jahren zum so genannten Lössabkommen, das für die Rekultivierung die Verwendung des fruchtbaren Lösses vorschreibt. Erst dieser Löss ermöglicht es, bei der Rekultivierung Qualitäten zu erreichen, wie sie der Landwirt von seinen gewachsenen Böden her kennt.
Der technische und biologische Fortschritt führte bereits mit den ausgehenden 1950er Jahren zu einer bis heute fortdauernden Technisierung und Intensivierung der Landwirtschaft. Ging es dabei zunächst um die möglichst große Produktion von Nahrungsgütern, so gewinnen in jüngster Zeit agrarökologische Fragestellungen zunehmende Bedeutung. Für die Landwirtschaft hat Umweltverträglichkeit – ein vielzitiertes Schlagwort – besondere Bedeutung: Landwirtschaftliche Tätigkeit steht schließlich auf der Grundlage natürlicher Ressourcen. Moderne Landwirtschaft kann nicht gegen, sondern nur mit der Natur Erfolg haben.
Anspruchsvollere Kulturpflanzen haben deutlich gemacht, wie empfindlich landwirtschaftliche Produktions- und Nutzungssysteme sind. Davon waren auch umfangreiche Rekultivierungsflächen betroffen: Wo es an der nötigen Sorgfalt bei der Behandlung des Lösses fehlte, haben die Kulturpflanzen nicht die gewünschten Erträge erzielen können. So löste die Kritik der Neuland-Bewirtschafter Anfang der 1980er Jahre ein umfassendes Programm wissenschaftlicher Untersuchungen und Bodenverbesserungen aus. Ihre Erkenntnisse haben geholfen, Rekultivierungstechnik und Landbewirtschaftung weiterzuentwickeln. Schließlich konnte die von der Natur gesetzte und vom Landwirt verlangte Zielvorgabe erreicht werden.
Das gestiegene Umweltbewusstsein, die Notwendigkeit, den EU-Agrarmarkt zu reformieren, und nicht zuletzt die sozialen Bedürfnisse von Landwirtsfamilien setzen heute weitergehende Forderungen. Die landwirtschaftliche Nutzfläche wird nicht mehr nur als Produktionsfaktor, sondern als wichtiger Bestandteil der Landschaft verstanden. Die rekultivierten Feldfluren müssen auch der Erholung und dem Natur- und Artenschutz dienen. So ist die Gegenwart der Rekultivierung durch ein Zusammenwirken aller Disziplinen mit einem ganzheitlichen Ansatz gekennzeichnet.